Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten), PDF
Rang: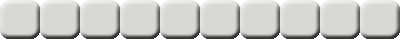 0% (656)
0% (656)
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten), PDF
Rang:
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
vom 11. Juni 1913 in Sachen Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen Urech.
| |
Lebensmittelpolizei. Begriff des Lebensmittels im Sinne des BG vom 8. Dezember 1905. Die Aufzählung in der Verordnung vom 29. Januar 1909 ist keine erschöpfende. Die sog. Maggi-Würze ist ein Lebensmittel im Sinne des BG.
| |
Sachverhalt: | |
A. | |
Am 11. Oktober 1912 wurde vom Lebensmittelinspektorat Baselland gegen Urech-Marti, Spezereihändler in Birsfelden, Anzeige gestützt auf Art. 37 des Lebensmittelgesetzes erhoben. Die Untersuchung ergab, daß Urech ein Gemisch von Maggi-Würze und Knorr-Sos oder Maggi-Würze, Knorr-Sos und Wasser als reine Maggi-Würze verkaufe. In seiner Einvernahme bestritt Urech jede Verfälschung.
| |
B. | |
Durch Urteil vom 21. Januar 1913 hat das Polizeigericht von Arlesheim den Beklagten wegen Verletzung des Art. 37 des Lebensmittelgesetzes durch Verfälschung von Maggi-Würze zu einer Buße von 30 Fr. verurteilt.
| |
C. | |
Gegen dieses Urteil rekurrierte der Beklagte an die Polizeikammer des Obergerichtes des Kantons Basel-Landschaft, welche durch Urteil vom 28. Februar 1913 den Beklagten freisprach. Zur Begründung wird in erster Linie geltend gemacht, daß Maggi-Würze kein Lebensmittel im Sinne des Gesetzes sei, da sie in der Verordnung des Bundesrates über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 29. Januar 1909, die gestützt auf Art. 54 des Lebensmittelgesetzes erlassen wurde und eine abschließende Aufzählung aller derjenigen Gegenstände enthalte, die als Lebensmittel zu betrachten seien, nicht erwähnt werde. Sodann sei davon auszugehen, daß dem Gesetze nur die sog. natürlichen Lebensmittel, allerdings mit teilweise üblicher Umarbeitung, unterstellt seien. Alles was durch chemisches Verfahren hergestellt und als Nahrungsmittel in den Verkehr gebracht werde, falle daher nicht unter das Lebensmittelgesetz. | |
Gegen dieses Urteil, das dem Bundesrat am 24. März 1913 zugestellt wurde, hat diese Behörde durch die Bundesanwaltschaft am 3. April bei der Regierung des Kantons Basel-Landschaft die Kassationsbeschwerde angemeldet. Durch Eingabe vom 11. April 1913 an den Kassationshof des Bundesgerichtes hat die Bundesanwaltschaft die Beschwerde begründet und die Anträge gestellt:
| |
"1. Es sei das Urteil der Polizeikammer des Obergerichtes des Kantons Basel-Landschaft in Sachen Urech wegen Verletzung eidgenössischer Rechtsvorschriften aufzuheben.
| |
2. Der Prozeß sei an die kantonalen Behörden zu neuer Beurteilung zurückzuweisen, in der Meinung, daß die der Kassation zu Grunde liegende rechtliche Beurteilung auch ihrer Entscheidung zu Grunde zu legen sei (Art. 172 OG)."
| |
E. | |
Der Kassationsbeklagte Urech hat beantragt, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten; eventuell sei die Beschwerde abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
| |
Erwägung 1 | |
1. Der Kassationsbeklagte begründet seinen Antrag auf Nichteintreten damit, daß die Beschwerde verspätet eingereicht worden sei. Die Zustellung des Urteiles an den Bundesrat habe am 24. März 1913 stattgefunden, die Kassationserklärung sei aber erst am 5. April beim Obergericht eingelangt, also nach Ablauf der zehntägigen Frist des Art. 164 OG. Die damit aufgeworfene Frage nach Auslegung des Art. 165 Abs. 2 OG ist nicht neu. Das Bundesgericht hat bereits einmal entschieden, daß es für die rechtzeitige Einlegung der Kassationsbeschwerde nicht auf den Zeitpunkt der Einreichung bei der kantonalen Gerichtsstelle, sondern lediglich auf den Zeitpunkt der Einlegung bei der Kantonsregierung ankomme, da der Regierungsrat nicht als Vertreter oder Bote des Bundesrates erscheine, sondern als Vertreter des kantonalen Gerichtes (AS 27 I S. 538 [= BGE 27 I 537 (538)]; vergl. im gleichen Sinne Reichel, Komm. zu Art. 165 OG Anm. 2; Weiß, Die Kassationsbeschwerde in Strafsachen eidgenössischen Rechtes, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht Bd. XIII S. 157). Diese Auffassung entspricht allein der Art des Verkehrs des Bundesrates mit den Kantonen. Der Bundesrat wendet sich in der | |
Erwägung 2 | |
2. In der Sache selbst ist in erster Linie zu untersuchen, was unter dem Begriff "Lebensmittel", wie er im Gesetze enthalten ist, zu verstehen ist. Aus der Entstehungsgeschichte, auf die sich die Antwort beruft, ergeben sich keine ganz bestimmten Anhaltspunkte. Als Zweck des Gesetzes wird in der Botschaft des Bundesrates (vergl. B.-Bl. 1899 I S. 615) genannt, einerseits den Konsumenten vor Gesundheitsschädigung und Ausbeutung zu bewahren, andererseits den reellen Produzenten (Landwirt und Fabrikant) und Handelsmann vor unredlicher Konkurrenz zu schützen. Die Ausführungen der Kommissionsberichterstatter im Ständerat und Nationalrat (vergl. stenographisches Bulletin, Jahrgang 1899 S. 254 Spalte rechts; Jahrg. 1903 S. 416 und 417) entwickeln diesen Grundgedanken weiter, ohne sich näher über diejenigen Gegenstände auszusprechen, die unter den Schutz des Gesetzes fallen sollen. Aus einer Andeutung des Kommissionsreferenten im Nationalrat (stenographisches Bulletin, Jahrg. 1903 S. 441 Spalte links) ist jedoch zu schließen, daß der Begriff Lebensmittel nicht in einem zu engen Sinne aufgefaßt werden | |
Erwägung 3 | |