Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang: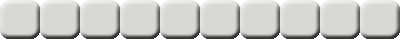 0% (656)
0% (656)
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang:
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
5. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn und A. GmbH (Beschwerde in Strafsachen) | |
6B_181/2018 vom 20. Dezember 2018 | |
Regeste | |
Art. 196, Art. 280 lit. b, Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 272 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 2, Art. 141 Abs. 1 StPO; polizeiliche Videoüberwachung am Arbeitsplatz; Beweisverwertungsverbot.
| |
Sachverhalt | |
B. Die Staatsanwaltschaft Solothurn erhob am 24. August 2016 Anklage gegen X. wegen einfachen Diebstahls, begangen an insgesamt sieben Tagen in der Zeit vom 10. Juni 2015 bis zum 18. Juli 2015, zum Nachteil der A. GmbH. Der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt sprach X. am 18. November 2016 vom Vorwurf des Diebstahls frei. Dagegen erhob die A. GmbH Berufung.
| |
C. Das Obergericht des Kantons Solothurn erklärte X. am 4. Januar 2018 des mehrfachen geringfügigen Diebstahls, begangen am 10. und am 13. Juni 2015 für schuldig und verurteilte sie zu einer Busse von Fr. 500.- bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. Hinsichtlich der übrigen vorgehaltenen Diebstähle stellte es das Verfahren mangels Strafantrag ein. Ferner verpflichtete es X. zu einer Schadenersatzzahlung an die A. GmbH. Die weiteren Zivilforderungen verwies es auf den Zivilweg. | |
E. Das Obergericht des Kantons Solothurn beantragt mit Vernehmlassung vom 28. August 2018 die Beschwerdeabweisung. Die A. GmbH stellt mit Eingabe vom 25. September 2018 den Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. X. hält in ihrem Schreiben vom 5. Oktober 2018 an ihren Anträgen fest. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
| |
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn wird mit Ausnahme von Ziffer 1 des Dispositivs aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
| |
2. Die Vorinstanz hält dagegen, dass es sich bei der von der Polizei durchgeführten Videoüberwachung nicht um eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 280 StPO handle. Wenn ein privater, nicht allgemein zugänglicher Raum mittels Videokamera überwacht werde, sei davon der Berechtigte an diesem Raum betroffen, mithin die A. GmbH (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 2). Diese habe als Mieterin der betroffenen Räumlichkeit und Inhaberin des Hausrechts um die Überwachung gewusst, diese gewollt und folglich in diese eingewilligt. Zufolge dieser Zustimmung liege keine genehmigungspflichtige Zwangsmassnahme vor. Dass die Beschwerdeführerin und alle weiteren Angestellten, im Unterschied zu den Geschäftsführern der | |
Die Beschwerdegegnerin 2 schliesst sich in ihrer Vernehmlassung im Wesentlichen der Auffassung der Vorinstanz an.
| |
Art. 280 f. StPO regelt die Zwangsmassnahme der Überwachung mit technischen Überwachungsgeräten. Gemäss Art. 280 lit. b StPO kann die Staatsanwaltschaft technische Überwachungsgeräte einsetzen, um Vorgänge an nicht öffentlichen oder nicht allgemein zugänglichen Orten zu beobachten oder aufzuzeichnen. Vorbehältlich der Bestimmungen von Art. 280-281 StPO richtet sich der Einsatz technischer Überwachungsgeräte nach den Art. 269-279 StPO, mithin nach den Bestimmungen über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Art. 281 Abs. 4 StPO).
| |
Laut Art. 272 Abs. 1 StPO bedarf die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht. | |
Erwägung 4 | |
Das in Art. 13 Abs. 2 BV verankerte Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist als Unterfall des Rechts auf Privatsphäre konzipiert (BGE 138 I 331 E. 5.1 S. 336 f.; BGE 137 I 167 E. 3.2 S. 172; Urteil 1B_510/2017 vom 11. Juli 2018 E. 3.3). Dieses garantiert dem Einzelnen die Herrschaft über seine personenbezogenen Daten, ohne Rücksicht darauf, wie sensibel die fraglichen Informationen sind (BGE 140 I 2 E. 9.1 S. 22 f.; BGE 138 II 346 E. 8.2 S. 359 f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 72 zu Art. 13 BV; je mit Hinweisen). Entgegen dem zu eng geratenen Wortlaut dieser Bestimmung schützt Art. 13 Abs. 2 BV damit nicht nur vor dem Missbrauch persönlicher Daten, sondern erfasst grundsätzlich die ganze Breite staatlicher, datenbezogener Tätigkeiten wie das Erheben, Sammeln, Aufbewahren, Speichern, Bearbeiten sowie Weiter- und Bekanntgeben an Dritte (OLIVER DIGGELMANN, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, N. 33 zu Art. 13 BV; SCHWEIZER, a.a.O., N. 74 zu Art. 13 BV). Entsprechend hat das Bundesgericht mehrfach festgehalten, dass die Erhebung, Aufbewahrung und Bearbeitung erkennungsdienstlicher Daten, worunter auch Videoaufnahmen fallen | |
4.4 An der Qualifikation als Zwangsmassnahme vermag auch der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin 2 als Hausherrin in die Videoüberwachung eingewilligt hat, nichts zu ändern. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, richteten sich die Ermittlungen gegen die Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin 2. Diese wurden im Nebenraum auf Video aufgezeichnet, ohne dass sie davon Kenntnis gehabt oder in diese Aufnahmen eingewilligt hätten. Obschon die Beschwerdeführerin zwar nicht Mieterin war und auch nicht das | |
Da die Videoüberwachung ohne Zutun der Staatsanwaltschaft von der Polizei Kanton Solothurn angeordnet und vom Zwangsmassnahmengericht nicht bestätigt wurde, sind die dadurch erlangten Erkenntnisse nach der unmissverständlichen, gesetzlichen Regelung von Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 277 Abs. 2 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO absolut unverwertbar und die entsprechenden Aufnahmen zu vernichten (Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 277 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde ist insofern begründet.
| |
4.6 Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin indes, soweit sie einen Freispruch verlangt und geltend macht, ohne die Videoaufnahmen hätte die Vorinstanz sie freigesprochen bzw. zwingend freisprechen müssen. Die Unverwertbarkeit der Videoaufnahmen hat nicht zur Folge, dass eine Verurteilung der Beschwerdeführerin per se ausser Betracht fällt. Zwar erachtet die Vorinstanz die Vorhalte vom 10. und vom 13. Juni 2015 unter anderem gestützt auf die | |
Unzulässig und mit der Unschuldsvermutung nicht vereinbar wäre indessen eine Schuldfeststellung für die Vorhalte vom 24. Juni 2015 und vom 1., 4., 15. und 18. Juli 2015, für welche das Strafverfahren definitiv eingestellt wurde. Endet das Verfahren mit einer Einstellung, fehlt es an einer rechtskräftigen Verurteilung, sodass die Unschuldsvermutung weiterhin zu wahren ist. Hieraus folgt, dass das Gericht mit seiner Entscheidbegründung nicht zum Ausdruck bringen darf, es halte die beschuldigte Person für schuldig (BGE 120 Ia 147 E. 3b S. 155; BGE 114 Ia 299 E. 2b S. 302; BGE 109 Ia 237 E. 2a S. 237 f.; ESTHER TOPHINKE, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 36 zu Art. 10 StPO; WOLFGANG WOHLERS, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl. 2014, N. 20 zu Art. 10 StPO mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). Die Umschreibung einer Verdachtslage bleibt jedoch zulässig (Urteil 1B_3/2011 vom 20. April 2011 E. 2.5.2; TOPHINKE, a.a.O., N. 36 zu Art. 10 StPO). |