Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang: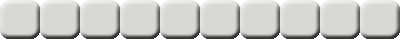 0% (656)
0% (656)
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
BGE 132 II 485 - Fernmeldekonzession
BGE 126 II 171 - Kraftwerke Oberhasli
BGE 134 I 23 - Vorsorgekasse Wallis
BGE 131 I 321 - Wasserversorgung Altdorf
BGE 130 I 26 - Ärztestopp
BGE 91 I 329 - Barret
BGE 105 Ia 330 - Meier et al.
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang:
Zitiert durch:
Zitiert selbst:
BGE 132 II 485 - Fernmeldekonzession
BGE 126 II 171 - Kraftwerke Oberhasli
BGE 134 I 23 - Vorsorgekasse Wallis
BGE 131 I 321 - Wasserversorgung Altdorf
BGE 130 I 26 - Ärztestopp
BGE 91 I 329 - Barret
BGE 105 Ia 330 - Meier et al.
13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. WWF Schweiz gegen A., Gemeinderat Cham und Regierungsrat des Kantons Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) | |
1C_631/2017 vom 29. März 2019 | |
Regeste | |
Erneuerung und Sanierung eines bestehenden Wasserkraftwerks, das sich auf ein ehehaftes Wasserrecht stützt (Art. 31 ff. und 80 GSchG; Art. 43, 54 lit. e und 58 WRG).
| |
Überblick über Rechtsprechung und Literatur zu den wohlerworbenen Rechten (E. 4) und den ehehaften Rechten (E. 5). Sondernutzungskonzessionen ohne zeitliche Begrenzung sind verfassungswidrig (E. 4.4).
| |
Das ehehafte Wasserrecht des Beschwerdegegners gewährt ein Sondernutzungsrecht an einem öffentlichen Gewässer (E. 6.3), das nicht unbefristet gelten kann, sondern nur bis zur Amortisation der getätigten Investitionen, längstens für 80 Jahre (E. 6.4). Es ist daher heute (entschädigungslos) dem aktuellen Recht zu unterstellen. Für die Fortführung der Wassernutzung bedarf es deshalb einer Konzession; einzuhalten sind die gesetzlichen Vorschriften für Neuanlagen, einschliesslich der Restwasservorschriften (E. 6.5).
| |
Sachverhalt | |
B. Am 5. Oktober 2015 reichte A. zwei Baugesuche für die Sanierung des Wasserkraftwerks Hammer ein: Das erste betrifft die Restwassersanierung und die Wiederherstellung der Fischgängigkeit, das zweite den Ersatz von Kraftwerksturbine und Generator sowie die Instandstellung und Automatisierung der Wehranlage. Am 26. Oktober 2015 stellte die Gemeinde Cham in eigener Sache ein Baugesuch für die Sanierung der östlichen Ufermauer in der Restwasserstrecke des Kraftwerks Hammer. Die Gemeinde Cham leitete alle drei Baugesuche zwecks Verfahrenskoordination an die Baudirektion des Kantons Zug weiter.
| |
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellte mit Schreiben vom 14. Juli 2015 die Finanzierung der Massnahmen zur Gewährleistung der freien Fischwanderung in Aussicht.
| |
C. Mit Beschluss vom 4. Oktober 2016 wies der Regierungsrat des Kantons Zug eine Einsprache des WWF Schweiz und des WWF Zug bezüglich der Sanierung des Wasserkraftwerks Hammer ab, soweit er darauf eintrat. Gestützt auf Art. 80 des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) legte er die entschädigungslose Restwassermenge des Kraftwerks Hammer auf 400 l/s | |
D. Gegen die regierungsrätlichen Beschlüsse erhob der WWF Schweiz am 14. November 2016 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zug, weil die festgelegte Restwassermenge deutlich zu tief sei und die vorgesehenen Fischwanderhilfen ungenügend seien, insbesondere mit Blick auf die Seeforelle. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde am 5. Oktober 2017 ab, soweit es darauf eintrat.
| |
E. Dagegen hat der WWF Schweiz am 20. November 2017 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
| |
(Zusammenfassung)
| |
2.1 Diese Regelung wurde mit Rücksicht auf die grossen finanziellen Konsequenzen getroffen, welche die integrale Durchsetzung der Restwasservorschriften bei bestehenden Konzessionen gehabt hätte (Botschaft des Bundesrats vom 29. April 1987 zur Volksinitiative "zur Rettung unserer Gewässer" und zur Revision des GSchG, BBl 1987 II 1061 ff. [nachfolgend: Botschaft], 1090 Ziff. 312.3). Diese verschaffen dem Konzessionär nach Massgabe des Verleihungsaktes ein wohlerworbenes Recht auf die Benutzung des Gewässers; das einmal verliehene Nutzungsrecht kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles und gegen volle Entschädigung zurückgezogen oder geschmälert werden (so Art. 43 des Bundesgesetzes vom | |
3.2 Der Beschwerdeführer macht dagegen geltend, der Schutz ehehafter Wasserrechte könne nicht weiter gehen als bei anderen | |
3.4 Das BAFU betont, dass der Staat nach heutiger Rechtsauffassung Sondernutzungsrechte an öffentlichen Gewässern nicht mehr auf unbefristete Dauer, sondern nur noch befristet, mittels Konzession, erteile. In BGE 127 II 69 habe das Bundesgericht klargestellt, dass altrechtliche Konzessionen, die noch ohne zeitliche Begrenzung erteilt worden seien, nachträglich zu befristen seien, weil es in höchstem Mass dem öffentlichen Interesse widerspreche, öffentliche Gewässer auf ewige Zeiten ihrem Zweck zu entfremden. Die Kantone behandelten die ehehaften Rechte sehr unterschiedlich. So habe der Kanton Thurgau alle ehehaften Rechte auf 2010 befristet. Andere Kantone versuchten im Einzelfall, mit dem Inhaber des ehehaften Rechts eine Befristung zu vereinbaren. Aus Sicht des öffentlichen Interesses an der Sicherung angemessener Restwassermengen sowie im Hinblick auf die Rechtsgleichheit sei es angezeigt, dass ehehafte | |
4. Ausgangspunkt ist der Rechtsgrundsatz, dass es keinen Anspruch auf Beibehaltung einer einmal geltenden Rechtsordnung gibt (BGE 130 I 26 E. 8.1 S. 60; Urteil 2C_561/2007 vom 6. November 2008 E. 3, in: ZBl 110/2009 S. 571, RDAF 2010 I S. 328). Unter Umständen können nach Treu und Glauben angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen verfassungsrechtlich geboten sein; diese haben jedoch nicht den Zweck, die Betroffenen möglichst lange von der günstigeren bisherigen Regelung profitieren zu lassen, sondern einzig, ihnen eine angemessene Frist einzuräumen, sich an die neue Regelung anzupassen (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 S. 40 f. mit Hinweisen; zu weiteren übergangsrechtlichen Möglichkeiten vgl. ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 102/1983 II S. 231 ff.).
| |
4.1 Die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) gewährleistet das Eigentum nur in den Schranken, die ihm im öffentlichen Interesse durch die Rechtsordnung gezogen sind. Nach ständiger Rechtsprechung sind namentlich die Anforderungen des Gewässerschutzes (Art. 76 BV), des Umweltschutzes (Art. 74 BV) und der Raumplanung (Art. 75 BV) zu beachten; diese gewichtigen öffentlichen Interessen sind der Gewährleistung des Eigentums grundsätzlich gleichgestellt (grundlegend BGE 105 Ia 330 E. 3c S. 336). Dementsprechend qualifiziert das Bundesgericht etwa Nichteinzonungen (BGE 119 Ib 124 E. 2a S. 128 mit Hinweisen) oder Zweitwohnungsbeschränkungen (BGE 144 II 367 E. 3.2 S. 373) als in der Regel entschädigungslos zulässige Inhaltsbestimmungen des Grundeigentums. Eine Eigentumsbeschränkung, die einer Enteignung gleichkommt und damit eine Entschädigungspflicht wegen materieller Enteignung auslöst (Art. 26 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 2 RPG [SR 700]), liegt nur ausnahmsweise vor, wenn der Eingriff besonders schwer wiegt oder dem Einzelnen ein unzumutbares Sonderopfer abverlangt wird (ständige Rechtsprechung seit BGE 91 I 329 E. 3 S. 339).
| |
4.2 Einzig die sogenannten "wohlerworbenen Rechte" weisen eine erhöhte Rechtsbeständigkeit auch gegenüber nachträglichen Gesetzesänderungen auf. Zwar sind auch diese Rechte in ihrem Bestand nicht absolut geschützt, d.h. in sie darf aus überwiegenden Gründen | |
4.3 Während wohlerworbene Rechte ursprünglich auf die Eigentumsgarantie gestützt wurden, steht heute der Schutz von Treu und Glauben im Vordergrund: Geschützt wird das Vertrauen des Bürgers in das Verhalten der staatlichen Behörden (grundlegend BGE 106 Ia 163 E. 1b S. 167 f.). Es handelt sich um Rechte, die im gegenseitigen Vertrauen zwischen dem Staat und dem Träger des Rechts darauf begründet worden sind, dass die Rechtsbeziehungen auf eine bestimmte Dauer grundsätzlich unverändert bleiben und einen verstärkten Schutz, namentlich vor späteren Eingriffen durch den Gesetzgeber, geniessen sollen (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1237; RIVA, Wohlerworbene Rechte, a.a.O., S. 80 ff. und 84 ff. mit Hinweisen). Dieser verstärkte Schutz dient namentlich dem Schutz von erheblichen Investitionen, die ansonsten von Privaten nicht getätigt würden (so bei Konzessionen; vgl. BGE 132 II 485 E. 9.5 S. 513). Andere vermögensrechtliche Ansprüche gegenüber dem Staat werden nur ausnahmsweise, bei qualifizierter Zusicherung, als wohlerworben anerkannt (vgl. BGE 134 I 23 E. 7.1 und 7.2 S. 35 f. mit Hinweisen zum öffentlichen Dienstrecht und zur beruflichen Vorsorge).
| |
4.5 In BGE 138 V 366 E. 6.1-6.4 S. 372 ff. erachtete das Bundesgericht schliesslich eine entschädigungslose Herabsetzung einer Zusatzrente der weitergehenden Vorsorge um einen Drittel als zulässig, obgleich diese dem Versicherten in Bestand und Höhe qualifiziert zugesichert worden war und damit als wohlerworbenes Recht gelte (E. 2.3 S. 369). Das Gericht führte aus, auch wohlerworbene Rechte seien nicht absolut geschützt. Die einseitige (entschädigungslose) Reglementsänderung rechtfertige sich aufgrund der ausserordentlichen Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts der Vorsorgeeinrichtung auf sehr lange Sicht, was zu einem bedeutenden Teil auf ein strukturelles Defizit zurückzuführen sei. Es handle sich um | |
5. Als ehehafte Rechte ("droits immémoriaux") werden Rechte bezeichnet, die ihren Ursprung in einer Rechtsordnung haben, die nicht mehr besteht. Sie können nach neuem Recht nicht mehr begründet werden, aber unter der neuen Rechtsordnung weiterbestehen (vgl. BGE 127 II 69 E. 4b S. 74; BGE 131 I 321 E. 5.1.2 S. 324 f.; je mit Hinweisen). In der Regel handelt es sich um Rechte, die vormals dem Privatrecht zugewiesen wurden, heute aber zum öffentlichen Recht gehören, ohne sich indessen reibungslos in dieses einzuordnen (SUTTER/MÜLLER, Historische Rechtspositionen - Fortwirkung oder Untergang? Überlegungen am Beispiel der staatlichen Pfarrerbesoldung im Kanton Bern, ZBl 2013 S. 475).
| |
ALFRED KÖLZ (Das wohlerworbene Recht - immer noch aktuelles Grundrecht?, SJZ 74/1978 S. 65) bezeichnet sie als "Zeugen unbewältigter juristischer Vergangenheit", weil man sich bei der Schaffung neuen Rechts gescheut habe, alte subjektive Rechtspositionen abzuschaffen. Sie hätten die Bezeichnung "wohlerworbene Rechte" erhalten und stünden seither sozusagen als erratische Blöcke im öffentlichen Recht (ähnlich KLETT, a.a.O., S. 94).
| |
5.2 WERNER DUBACH (Die wohlerworbenen Rechte im Wasserrecht, November 1979, in: Mitteilung Nr. 1 des Bundesamts für Wasserwirtschaft, 1980, S. 53 und 59 f.) kam dagegen in einem Rechtsgutachten zuhanden des Bundesamts für Wasserwirtschaft zum Ergebnis, dass ehehafte Wasserrechte zwar durch die Eigentumsgarantie geschützt seien, nicht aber den darüber hinausgehenden Schutz von | |
MOOR/POLTIER (Droit administratif, Bd. II, 3. Aufl. 2011, S. 25) führen den Schutz vertraglicher und vertragsähnlicher Rechte gegenüber dem Gesetzgeber auf den Grundsatz "pacta sunt servanda" zurück und halten die Rechtsfigur des wohlerworbenen Rechts für entbehrlich. Ihres Erachtens geniessen ehehafte Rechte denselben Status wie jedes andere private vermögenswerte Recht, d.h. sie unterliegen dem Schutz der Eigentumsgarantie (so auch MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, Bd. III, 2. Aufl. 2018, S. 663/664).
| |
5.4 SUTTER/MÜLLER bezeichnen historische Rechtspositionen als "terra incognita" in der Rechtsdogmatik (a.a.O., S. 472). Diese müssten - wie alles staatliche Recht - ihre Grundlage in der geltenden Verfassung finden (S. 473 f.), und ihre Beständigkeit könne nicht grösser sein als die ihnen zugrunde liegenden Verfassungsgarantien, insbesondere das Prinzip des Vertrauensschutzes, die Eigentumsgarantie und das Verhältnismässigkeitsprinzip (S. 477). Ob und wenn | |
6.2 Schon nach ihrem Wortlaut begründete diese Verfügung kein neues, wohlerworbenes Recht, sondern anerkannte ein | |
Rechtsgrund ist somit nicht die Anerkennung (verbunden mit dem Eintrag im Grundbuch). Vielmehr handelt es sich um eine ehemals mit dem Eigentum am Ufergrundstück zusammenhängende Nutzungsbefugnis, die einseitig, durch Okkupation, ausgeübt wurde. Diese Nutzungsbefugnis wurde 1922 zugunsten der neu eingeführten staatlichen Wasserrechtsverleihung beseitigt (vgl. dazu BGE 48 I 580 E. 2 S. 597 ff.). Ausgenommen wurden jedoch Fälle, in denen von der Befugnis bereits tatsächlich - durch Erstellung und Gebrauch von Wasserwerken - Gebrauch gemacht worden war: Diese bereits ausgeübten Rechte wurden weiter anerkannt (vgl. BGE 48 I 580 E. 2 S. 601 ff.) und als wohlerworbene ehehafte Wasserrechte eingestuft (vgl. LIVER, a.a.O., S. 230).
| |
Der Investitionsschutz rechtfertigt die Aufrechterhaltung überkommener Rechte nur bis zur Amortisation der getätigten Investitionen, | |
Diese Anpassung an das heutige Recht muss bei erster Gelegenheit erfolgen und ist jedenfalls Voraussetzung für die Erneuerung der Wasserkraftanlagen. Bau- und Ausnahmebewilligungen dürfen daher erst erteilt werden, wenn eine Konzession erteilt worden ist.
| |
Da es vorliegend an dieser Voraussetzung fehlt, ist die Beschwerde schon aus diesem Grund gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Die Sache ist an den Regierungsrat zurückzuweisen, um das weitere Vorgehen in den hängigen Baugesuchsverfahren zu prüfen.
| |
6.6 Reparatur und Wiederinbetriebnahme der alten Turbine sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (vgl. nicht publ. E. 1.2). Auch diese Nutzung der Wasserkraft muss jedoch - sofern sie aufrechterhalten werden soll - den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Diesen kann sich der Beschwerdegegner nicht durch Rückzug des Baugesuchs entziehen. |